
Die Enttäuschung klatscht ihr wie ein nasser Lappen ins Gesicht. Keine Einladung zum Essen, nicht mal Blumen! Nur ein flüchtiger Begrüßungskuss, dann plumpst er aufs Sofa. Fußball. Sie steht da, im Bauch eine Menge Wut. Tränen wollen raus. Kein Zögern mehr beim Griff zur Jacke. Er hat schon wieder den Hochzeitstag vergessen. In fast jeder Partnerschaft passieren Dinge, die so wehtun, dass erst mal Funkstille herrscht. Verletzte Gefühle, Enttäuschung und Wut machen sich breit: Wie konntest du nur!? Wer verletzt wurde, zieht sich zurück. Wer verletzt hat, möchte alles wieder gutmachen, erklärt, entschuldigt sich. Doch trotz aller Mühe und Beteuerungen – verzeihen klappt nicht. Die schmerzende Erinnerung bleibt, obwohl der andere sich tausendmal entschuldigt. Denn das genügt nicht.
„Passiert in Partnerschaften etwas, was die Substanz angreift, dann geht es nicht mehr ums Verzeihenkönnen“, erklärt die Diplom-Psychologin Carin Cutner-Oscheja aus Hamburg. „Entschuldigungen sind Teil unserer Höflichkeitskultur. Wir verwenden sie oft und floskelhaft.“ Rempeln wir in der U-Bahn jemanden an, verspäten wir uns oder verschütten den Rotwein, ist das für „Täter“ und „Opfer“ gleichermaßen okay. Doch in der Liebe geht es nicht um Etikette. „Hier können sich nur mit dem intensiven Prozess des Vergebens Wunden schließen und wirklich heilen“, sagt Cutner-Oscheja.
Die Fehler verzeihen können
Vergeben heißt: annehmen, was passiert ist, und die Wut loslassen. Klingt einfach. Doch wie schwer es uns in Wahrheit fällt, spüren wir schon bei banalen Konflikten: Fährt er eine Beule ins neue Auto, rückt das fortan jedes Fehlverhalten im Straßenverkehr seinerseits in ein anderes Licht: „Du schon wieder!“ Streit ist programmiert. Auch ein vergessener Hochzeitstag kann Jahre später wieder aufgewärmt werden: „Typisch! Genau wie damals, als...!“ Da scheint es nahezu unmöglich, etwa eine ohne Aussprache getroffene Entscheidung („Du, übrigens, ich gehe beruflich sechs Monate nach England“) oder gar einen Seitensprung zu vergeben. Das liegt allerdings nicht nur an dem Vertrauensbruch selbst, sondern auch an einer häufigen Verwechslung: Vergeben bedeutet eben nicht Vergessen.
Vergeben ist nicht immer einfach
Je stärker Erinnerungen mit Gefühlen verknüpft sind, desto unmöglicher wird es, sie zu vergessen. Zuweilen bleiben sie ein Leben lang im Hinterkopf und kommen – ohne konstruktive Verarbeitung – immer wieder hoch. Pures Gift für jede Beziehung. Wegen solcher „unüberwindbaren Differenzen“ landen allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 180000 Ehen vor dem Scheidungsrichter. „Viele dieser Paare haben tief gehende Probleme nie wirklich be- sprochen“, sagt Cutner-Oscheja. Dabei ist Vergebung ein urchristliches Motiv der Nächstenliebe. Sollten wir nicht zugänglicher für die Friedenspfeife sein? „Fühlen wir uns ungerecht behandelt, warten wir auf Wiedergutmachung“, antwortet Cutner-Oscheja. Eine Delle im neuen Auto – kein Problem: in die Werkstatt fahren, ausbeulen lassen, fertig. Aber das Leben lässt sich nicht einfach auf null zurücksetzen. Eine Lüge bleibt ausgesprochen, das „eine Mal“ mit seiner Kollegin ist nicht rückgängig zu machen. Wir erwarten Wiedergutmachung, wo sie unmöglich ist.
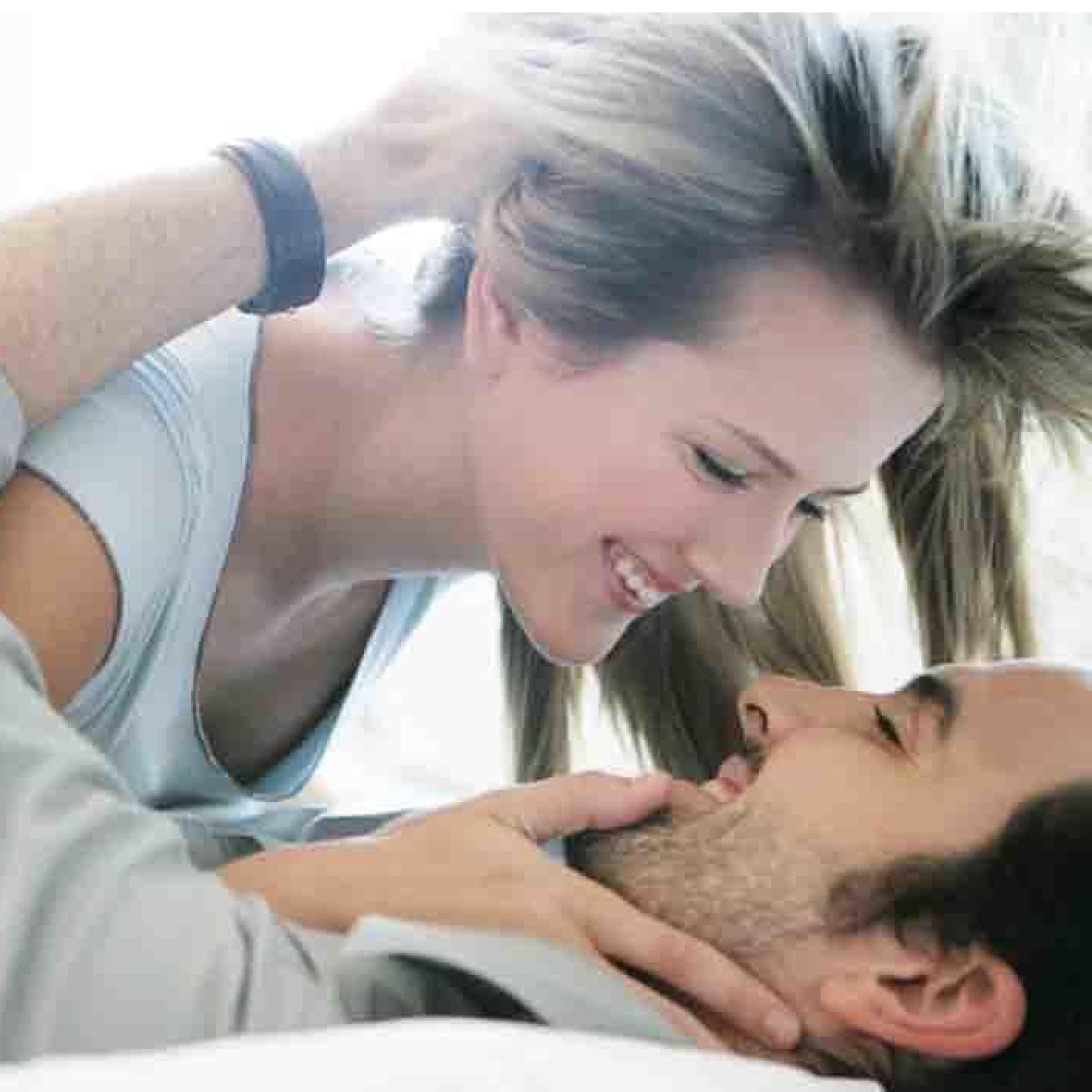
Obendrein ist Nichtvergeben eine indirekte Form der Bestrafung, ein Druckmittel. Wir wollen (und genießen es gelegentlich), dass der andere leidet. Er soll ruhig spüren, wie schlecht es uns geht, und Buße tun. Kurzfristig hilft das – vielleicht. Langfristig entsteht ein Teufelskreis.
Eine Auszeit hilft
Der, der nicht vergeben kann oder will, bleibt belastet. Der, dem nicht vergeben wird, fühlt sich hilflos und irgendwann nur noch ungerecht behandelt. Das gilt nicht nur für Paare. Auch mit den Eltern, Freunden oder Geschwistern können sich solche Schuld- und Sühneprozesse immer weiter hochschaukeln.
Sosehr wir es uns dann gelegentlich wünschen, Vergebung funktioniert nicht auf Knopfdruck. „Die Partner müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen und versuchen, die Motive und Hintergründe des anderen
zu verstehen“, sagt Cutner-Oscheja. Was ist da überhaupt mit uns passiert? Wie konnte es so weit kommen? „Schaffen es Menschen, dies miteinander aufzuarbeiten, kann aus schweren Situationen Verständnis wachsen und Verletzungen können gemildert werden.“ Im besten Fall heißt das: Die Verletzung aus der Vergangenheit verliert ihre Kraft für die Zukunft. Es hat gestern wehgetan, aber für unser Morgen spielt es keine Rolle mehr.
Bevor dieser Prozess in Gang kommt, braucht es zunächst emotionale Distanz. Direkt nach dem großen Knall ist kaum gut Kirschen essen. Cutner-Oscheja rät, sich eine Auszeit zu nehmen, um die Gedanken zu sortieren: „Es braucht Zeit und Selbstreflexion, bis ein erstes wohlwollendes Gespräch mit dem Partner möglich ist.“ Auch danach, während man wieder allein grübele, gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren: „Wer vergeben will, muss sich immer wieder klarmachen, dass er für den Partner Freund und nicht Feind sein möchte.“
Die fünf Schritte des Vergebens
1. Der erste Schritt besteht darin, die aufgewühlten Gedanken zu sortieren. Carin Cutner-Oscheja rät: „Unterscheiden Sie zwischen dem, was konkret vorgefallen ist, den Fakten und den Gefühlen, die bei Ihnen entstehen.“ So finden Sie die tatsächlichen Wurzeln der Verletzung.
2. Betrachten Sie die Hintergründe in einem ersten gemeinsamen Gespräch. Was genau hat zu den Verletzungen geführt? Versetzen Sie sich in die Lage des anderen. Können Sie nachvollziehen, warum er so gehandelt hat? Fragen Sie sich ehrlich: Will ich oder gefällt mir, dass der andere weiterleidet?
3. Schließen Sie einen Vertrag mit sich selbst: Ich will nicht mehr wütend sein und eine bessere Zukunft. Überlegen Sie mit dem Partner, was sich ändern muss, um neue Verletzungen zu vermeiden.
4. Schauen Sie sich bewusst die schönen und wertvollen Seiten Ihres Partners und Ihrer Beziehung an. „An diesem Punkt kann es passieren, dass wir keine positiven Antworten mehr finden“, sagt Cutner-Oscheja. „In so einem Fall kann Vergebung auch bedeuten, einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen.“
5. Loslassen, Akzeptieren. Es lässt sich nicht mehr ändern. Richten Sie ihren Blick nach vorn. Es hilft das "Problem" aufzuscheiben und es danach zu verbrennen.
Interview: Jeder muss für sich klären, was er vergeben kann
Carin Cutner-Oscheja, 56, ist Diplompsychologin und Paartherapeutin mit Praxis in Hamburg.
vital: Gibt es Dinge, die wir nicht vergeben können?
Carin Cutner-Oscheja: Im Grunde nicht. Immer wieder belegen Menschen, was alles möglich ist. Zum Beispiel Geschwister, die sich nach langem Erbstreit doch wieder an einen Tisch setzen können, und sogar Eltern, die es schaffen, dem Mörder ihres Kindes zu vergeben. Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber es zeigt, dass die Grenzen des Vergebens sehr weit gefasst werden können. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was er vergeben kann und was nicht.
Wie finde ich das heraus?
Das ist nicht leicht. Bei manchen Ereignissen merken wir: Das will ich so nicht! Das muss aufhören! Häufiger beachten Menschen ihre Grenzen jedoch nicht oder versuchen, sie zu ignorieren. Sie vergeben dem Partner, weil sie möchten, dass die Beziehung irgendwie weitergeht. Erst wenn sie körperlich oder seelisch krank werden, merken sie, dass sie sich zu viel vorgenommen haben.
Wir sollten also nicht „um des lieben Friedens willen“ etwas vergeben?
Nein, so eine Strategie bedeutet nicht vergeben, sondern nur nachgeben. Das Problem wird verlagert, indem wir Konflikte und verletzte Gefühle unter den Teppich kehren. Das Problem: Dieser Frieden ist nur von kurzer Dauer. Bei nächster Gelegenheit kommt alles wieder hoch.
Wirkt Vergebung befreiend?
Absolut. Wenn ein Paar es beispielsweise schafft, einen Seitensprung zu vergeben, kann das eine große Chance für die Partnerschaft sein. Der betrogene Partner kommt aus der Opferrolle heraus und kann wieder aktiv werden, frei nach dem Motto: Ich weiß jetzt, was mich in diese Lage gebracht hat, und kann viel dafür tun, dass es nicht wieder so weit kommt.