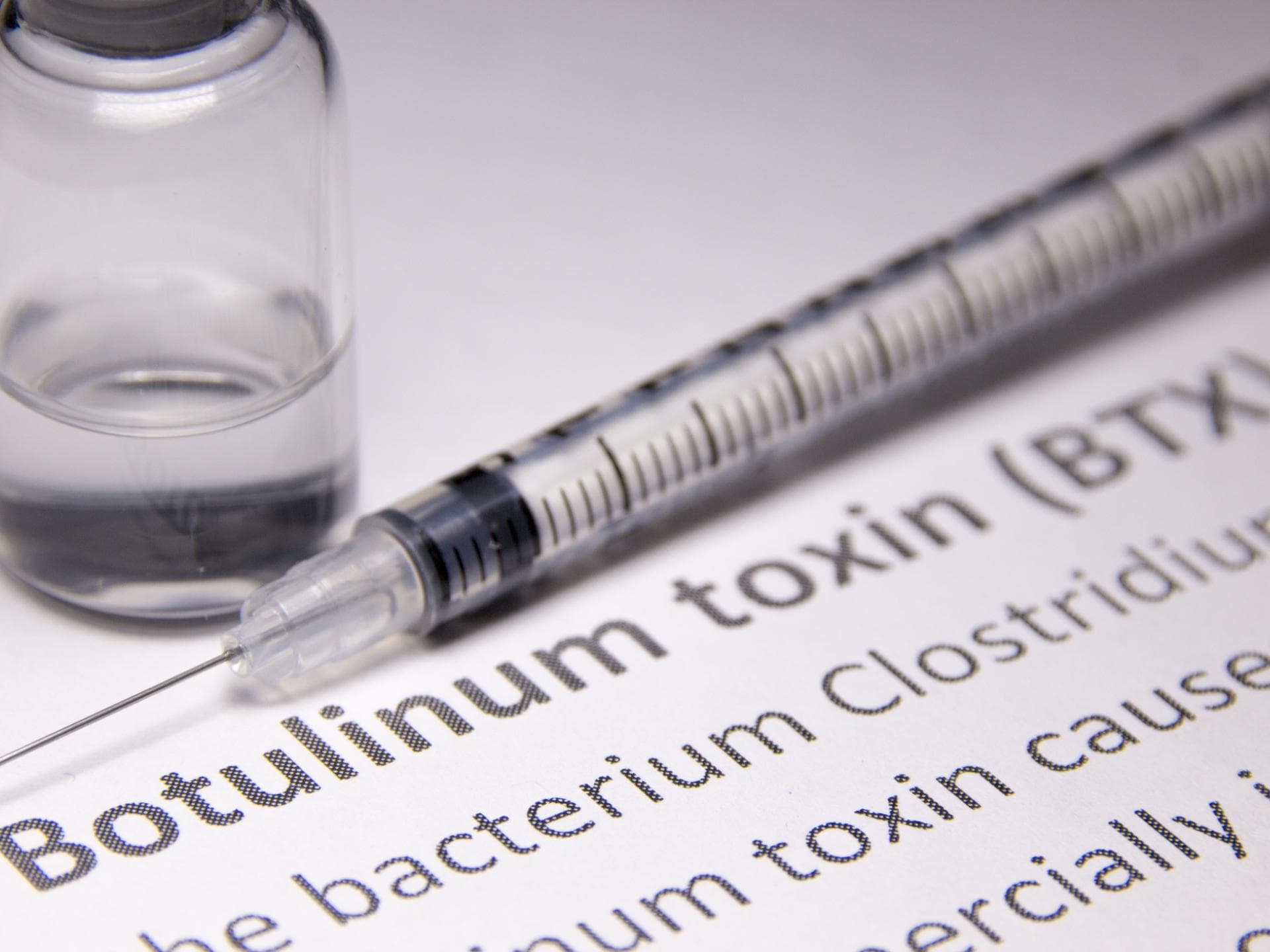Was versteht man unter Harninkontinenz?
Harninkontinenz beschreibt den unwillkürlichen und unkontrollierten Urinverlust. Im Volksmund hat sich der Begriff „Blasenschwäche“ durchgesetzt. Wer unter einer „schwachen Blase“ leidet, wird meist vom Harndrang „überfallen“ und schafft es kaum noch rechtzeitig zur Toilette. Der Harndrang und der damit einhergehende unkontrollierte Harnverlust (Inkontinenz) kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Lesen Sie auch:Hausmittel bei Inkontinenz >>
Wer ist betroffen?
Schätzungen zufolge ist etwa jede dritte bis vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben inkontinent – und leidet beispielsweise unter einer Dranginkontinenz mit Reizblase. Weniger häufig sind Männer vom unkontrollierten Urinverlust betroffen: Nur ca. 11 Prozent aller Männer in Deutschland weisen eine Form der Blasenschwäche auf. Noch seltener ist die Stuhlinkontinenz.
Lesen Sie auch: Tampons bei Stuhlinkontinenz: Was ist ein Analtampon? >>

“Blasendoktor” Prof. Dr. Stephan Roth ist seit 1997 Direktor der Urologischen Universitätsklinik Wuppertal und Lehrstuhlinhaber für Urologie an der Universität Witten/Herdecke. Mehr erfahren Sie unter blasendoktor.de.
Welche Formen gibt es?
Fachärzte unterscheiden zwischen:
- Belastungsinkontinenz, auch unter Stressinkontinenz bekannt: Patientinnen und Patienten leiden unter plötzlichem Harnverlust bei körperlicher Anstrengung, beispielsweise beim Sport, dem Heben schwerer Gegenständen oder beim Husten. Größtenteils verspüren Betroffene dabei keinen Harndrang.
- Dranginkontinenz: Betroffene mit einer sogenannten Reizblase verspüren einen schlagartigen Drang, auf die Toilette zu müssen. Das Bedürfnis ist dermaßen stark, dass sie oft schon auf dem Weg zum Klo Urin verlieren.
- Mischinkontinenz: Hierbei handelt es sich um eine Mischform aus Variante 1 und 2. Patienten leiden unter einem unwillkürlichen Harndrang mit teils unfreiwilligem Urinverlust als Folge von körperlicher Anstrengung.
Mehr dazu:Ursachen, Formen und Behandlungsmöglichkeiten von Harninkontinenz >>
Suchen Sie sich Hilfe

Scheuen Sie sich nicht, bei einem Arzt oder einer Ärztin Hilfe zu suchen. Der Facharzt kann abklären, welche Form der Inkontinenz vorliegt – um dann die Ursache zu finden und eine passende Therapie einzuleiten. Eine Behandlungsmöglichkeit ist die Anwendung von Botulinumtoxin gegen Inkontinenz. Doch nicht immer ist Botox bei Blasenschwäche das richtige Medikament für alle Patientinnen und Patienten.
Im Video: Tabuthema Inkontinenz - Sam (22) will aufklären
Blasendoktor im Interview: "Botox sollte nie am Anfang der Therapiebemühungen stehen"
Botox hilft bekanntermaßen gegen Falten oder übermäßiges Schwitzen. Doch auch eine Injektion in die Harnblase kann sinnvoll sein. Allerdings nur dann, wenn Sie unter einer Reizblase leiden, also einer überaktiven Harnblase. Facharzt Prof. Dr. Stephan Roth aus Wuppertal klärt über den Wirkstoff und die Behandlung auf.
vital.de: Wie wirkt Botox bei Inkontinenz/Blasenschwäche?
Prof. Roth: Botox ist ein hochverdünntes Nervengift, das die Impulsübertragung an der Nerven-Muskelverbindung blockiert. Deshalb führt es zu einer Minderung der Aktivität des Blasenmuskels und dämpft den Blasendrang. Aber aufgepasst: Bei der Belastungsinkontinenz, wenn man Urin beim Husten und Springen verliert, hilft es überhaupt nicht. Hier ist meist der Schließmuskel zu schwach und der unterstützende Bandapparat überdehnt.
Siehe auch: Wie kam Botox in die Blase? >>
vital.de: Wie läuft die Injektion ab – und wie lange dauert es, bis die Wirkung einsetzt?
Prof. Roth: Das Medikament wird mit einer dünnen Nadel tief in den Blasenmuskel gespritzt und gelangt dann mit der Flüssigkeitsverteilung im Zwischenzellraum zu den elektrischen Schaltstellen des Blasenmuskels. Deshalb dauert es einige Tage, bis die Betroffenen den Effekt der Blasenberuhigung spürbar bemerken.
vital.de: Wie oft kann man Botox in die Harnblase spritzen?
Prof. Roth: Bis auf ganz wenige Ausnahmen gibt es keine Hinweise, dass Betroffene sich an Botulinum gewöhnen oder allergisch reagieren. Deshalb kann man es beliebig oft wiederholen. Allerdings empfiehlt man heutzutage, eine eventuell erforderliche erneute Injektion frühestens nach 3 Monaten durchzuführen, um die Bildung blockierender Antikörper zu verhindern.
Auch spannend: Urin-Inkontinenz bei Frauen >>
vital.de: Wie lange hält die Wirkung an?
Prof. Roth: Anfangs wird man bei der Blasenüberaktivität mit einer geringen Dosis von 100 Einheiten beginnen und dann bei einer erforderlichen Wiederholung die Dosis je nach Wirkdauer eventuell steigern. Tatsächlich hat jeder Betroffene eine individuelle „Idealdosis“, die dann meistens für mindestens 6 Monate, aber auch 12 Monate anhält. In einem Viertel der Fälle hält die Wirkung aber auch deutlich länger an.

vital.de: Was kostet Botox für die Harnblase?
Prof. Roth: Es gibt inzwischen verschiedene Anbieter des Wirkstoffes Botulinumtoxin. Da kosten 100 Einheiten mindestens 240 € und die injizierte Maximaldosis beträgt 300 Einheiten. Bei einer ambulanten Behandlung kommen dann die Narkose- und Materialkosten und Arztkosten hinzu. Je nach Grunderkrankung kann die Therapie auch als Krankenhausleistung erbracht werden. Dann werden die Medikamentenkosten vom Krankenhaus übernommen.
vital.de: Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Prof. Roth: Bei der Erstgabe kann man schwer abschätzen, wie stark der Beruhigungseffekt der Harnblase durch das Botox ist. Deshalb gibt man hier nur eine geringe Menge. Trotzdem kann es bei ungefähr 5 Prozent der Behandelten passieren, dass es zu einer Blasenlähmung kommt. Dann müssten sich die Betreffenden selbst mit einem Katheter die Blase entleeren oder einen Katheter tragen, bis die Blasenlähmung nach ein paar Wochen verschwindet. Bei diesen „Überreagierern“ würde man bei einer Wiederholungsbehandlung die Dosis reduzieren.
vital.de: Wem würden Sie eine Botox-Behandlung bei Blasenschwäche empfehlen – und wem nicht?
Prof. Roth: Bei der im Volksmund bezeichneten Blasenschwäche, wenn man den Urin bei einer Druckerhöhung im Bauchraum wie bei Husten oder Springen verliert, hilft Botox überhaupt nicht und darf nicht gespritzt werden. Es hilft nur bei einer überaktiven Blase, also einer Blase, die sich plötzlich krampfartig zusammenzieht und der Druck dann mitunter so stark wird, dass die Betroffenen Urin verlieren (Reizblase). Aber Botox sollte nie am Anfang, sondern immer erst am Ende der Therapiebemühungen stehen, wenn alle anderen nicht-operativen Maßnahmen versagt haben.
vital.de: Welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Prof. Roth: Es ist wichtig zu wissen, dass die jugendlich dehnungsfähige Blase im höheren Alter versteifen und dadurch an Elastizität verlieren kann. Hier hilft ein Blasentraining, bei dem durch regelmäßiges Zurückhalten beim Harndrang die Blase allmählich wieder vergrößert wird. Quasi ein „Pilates für die Blase“.
Steht bei der Blase eine Rhythmusstörung im Vordergrund, gibt es medikamentöse Hilfen, die Blase zu beruhigen. Eine wenig bekannte und in der Hälfte aller Fälle erfolgreiche Therapie ist die sogenannte Neuromodulation der Blase. Durch eine leichte Elektrostimulation des hinteren Schienbeinnervens am Innenknöchel kann die Impulsverarbeitung der Blasennerven im Bereich des Rückenmarks normalisiert werden.
Medikamente gegen die Reizblase
Medikamente sind eine nicht-operative Methode, um eine Reizblase in den Griff zu bekommen. Zu den gängigsten, medikamentösen Behandlungen zählt die Therapie mit sogenannten Anticholinergika. Das soll den Botenstoff Azetylcholin hemmen, der eine wichtige Schnittstelle zwischen Nerven und Muskel bildet. Jedoch: Die Anticholinergika bleiben meist nicht ohne Nebenwirkungen. Als Folge der Therapie kann es unter anderem zu Mundtrockenheit oder Verstopfung kommen. Auch die Konzentrationsfähigkeit von Patientinnen und Patienten kann unter der Behandlung leiden.